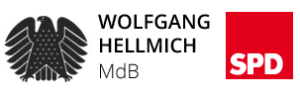Wolfgang Thierse: Über die Gesellschaft
Dies ist die – leicht gekürzte – Fassung einer Festrede, die Wolfgang Thierse Ende September bei der Bürgerstiftung in Berlin hielt.
http://www.thierse.de/reden-und-texte/reden/rede-buergerstiftung-berlin/
Ich habe den unabweisbaren Eindruck, dass unsere Gesellschaft polarisiert und auf vielfache Weise gespalten ist. Auf der einen Seite vielfältiges demokratisches Engagement, gelebter Gemeinsinn. Junge Leute gehen auf die Straße für ihre und unsere Zukunft. Auf der anderen Seite erlebe ich, wie sich die Stimmung verändert und verschlechtert hat. Dass der Streit härter, die Kontroversen schärfer geworden sind. Die rhetorischen und gewalttätigen Attacken gegen demokratische Politiker und Journalisten haben zugenommen, von Drohungen bis zum Mord ist tätiger Hass alltäglich geworden. Und dann ein solches Urteil des Berliner Landgerichts! Ich bin fassungslos. Richter nicken zur Verrohung der kommunikativen Sitten! Sie schützen die Anonymität von Gemeinheiten!
Aber darüber hinaus: Es wird insgesamt immer schwieriger, sich auf gemeinsame Wahrnehmungen von Realität zu einigen. Und dass Konsense oder wenigstens Kompromisse schwieriger werden, ja dass diese gänzlich in Verruf geraten sind. Die Wahlergebnisse der vergangenen Wochen und Monate haben die Stimmung nicht verbessert, sondern die Spaltung noch sichtbarer gemacht.
„Gespaltene Mitte. Feindselige Zustände“ – so ist der dazu passende Titel einer Sozialanalyse der Leipziger Universität aus dem vorigen Jahr. Und alle Stimmungsabfragen der letzten Jahre zeigen das gleiche zwiespältige Bild. Eine große Mehrheit der Deutschen meint, dass es ihnen gut gehe. Eine ebenso große Mehrheit aber äußert zugleich die Befürchtung, dass es nicht so bleiben, dass es uns nicht weiterhin und dauerhaft so gut gehen werde. Und dass der Wohlstand ungleich verteilt sei. Mit der positiven ökonomisch-sozialen Gegenwartsbeurteilung korrespondiert auf eigentümliche Weise eine starke Zukunftsunsicherheit und das Empfinden sozialer Ungerechtigkeit.
Auch die „Generation Mitte“-Studie von Allensbach, die sich den 30-59jährigen widmet und vor einer Woche veröffentlicht wurde, zeigt ein vergleichbares Bild: Eine deutliche Mehrheit sagt, es gehe ihnen persönlich gut. Eine noch größere Mehrheit aber macht sich Zukunftssorgen und eine nochmals größere Mehrheit beklagt das schlechter und aggressiver gewordene gesellschaftliche Klima.
Optimismus oder wenigstens Gelassenheit fallen gegenwärtig offensichtlich schwer. Im Gegenteil. Ein vertrauter, gefährlicher, angstgetriebener Mechanismus wird wieder sichtbar und wirksam: Je komplexer und bedrohlicher die Problemfülle erscheint, umso stärker das Bedürfnis nach den einfachen Antworten, umso stärker die Sehnsucht nach den schnellen Lösungen, ja nach Erlösung, nach der starken Autorität. (Wir kennen das aus unserer deutschen Geschichte.) Das ist die Stunde der Populisten, der großen und kleinen Vereinfacher und Schuldzuweiser und Verfeinder. Wir erleben sie in unserer Nachbarschaft: in Holland und Frankreich, in Ungarn und Polen, in Österreich und Italien, in den USA eben auch und ebenso in Deutschland mit der AfD.
Schauen wir ringsum: Die liberale, offene, pluralistische, rechtsstaatliche und sozialstaatliche Demokratie ist nicht die Regel, sie ist eher die Ausnahme. Sie ist ein zerbrechliches politisches System, sie erweist sich als gefährdet, selbst in Europa. Der Blick nach Polen, nach Ungarn, nach Russland, in die Türkei erinnert an eine beunruhigende historische Erfahrung: „Zur Abschaffung von Demokratie eignet sich nichts besser als Demokratie“, so hat Peter Sloterdijk zutreffend bemerkt. In dem Buch der amerikanischen Politikwissenschaftler Levitsky und Ziblatt „Wie Demokratien sterben“ findet sich die Beobachtung, dass heute Demokratien nicht durch Putsch zerstört werden, sondern auf demokratischem Wege, etwa durch Wahlen und ihre Folgen (exemplifiziert am Beispiel der USA und Ungarns und Polens).
Dass die Demokratie eben nicht mehr selbstverständlich, sondern gefährdet ist, das fordert zu ihrer aktiven Verteidigung heraus. Gerade auch in dem, was Krise der Parteiendemokratie, Vertrauenskrise der Volksparteien genannt wird. Gerade auch gegen das, was viele zu Recht als Vergröberung der kommunikativen Sitten erleben: Die Lügen halten Hof als „alternative Fakten“, die sozialen Medien werden immer mehr zu Echoräumen der eigenen Vorurteile, der Entladung von Hass und der Steigerung von Aggressivität.
Wir bemerken gegenwärtig, dass unser Land, dass die deutsche Gesellschaft sich insbesondere durch Migration verändert. Sich auf diese Veränderung einzulassen, ist offensichtlich eine anstrengende Herausforderung. Sie erzeugt Misstöne und Ressentiments und macht vielen (Einheimischen) Angst, vor allem unübersehbar und unüberhörbar im östlichen Deutschland. Pegida ist dafür ein schlimmes Symptom, die Wahlerfolge der AfD sind ein anderes.
Die radikalen Veränderungsprozesse, die von vielen Menschen als bedrohlich empfundenen Beschleunigungen und Entgrenzungen, die der Begriff Globalisierung zusammenfasst, die Migrationsschübe, die Veränderungen der Arbeitswelt durch die digitale Transformation, die ökologische Bedrohung, die Ängstigungen durch Terrorismus, Gewalt, kriegerische Konflikte, insgesamt das Erleben einer „Welt in Unordnung“ – das alles verstärkt auf offensichtlich dramatische Weise das individuelle und kollektive Bedürfnis nach neuen (und auch alten) Vergewisserungen und Verankerungen, nach Identität, nach Sicherheit, eben nach Beheimatung.
Die Gefühle der Unsicherheit, der Gefährdung des Vertrauten und Gewohnten, der Infragestellung dessen, was Halt gibt und Zusammenhalt sichert, insgesamt Entheimatungsbefürchtungen und Zukunftsunsicherheiten – sie sind allerdings höchst ungleich verteilt. So gibt es – drei Jahrzehnte nach Friedlicher Revolution und Deutscher Einheit – eine West-Ost-Ungleichheit der Sicherheiten und Gewissheiten: Nach den ostdeutschen Erfahrungen eines Systemwechsels, eines radikalen Umbruchs sowohl ökonomisch-sozialer wie moralisch-kultureller Art, nach dem vielfachen Erlebnis der Entwertung und des Entschwindens der eigenen Lebenserfahrungen und Lebensleistungen.
Und zur Dialektik der Globalisierung gehört offensichtlich eine neue, vor allem kulturelle Spaltung der Gesellschaft (die allerdings die „älteren“ sozialen Spaltungen nicht zum Verschwinden bringt). Diese Spaltung wird in unterschiedlicher Terminologie beschrieben: zwischen den „Somewheres“ und „Anywheres“, zwischen dem „kosmopolitischen“, libertären, urbanen Teil der Bevölkerung und dem „kommunitaristischen“, lokalorientierten und gebundenen Teil. Wie angemessen diese Termini sind, sei hier nicht diskutiert aber doch festgehalten: Es sind ja nicht die kosmopolitischen Eliten, die Libertären, die auf den Wellen der Globalisierung Surfenden, die Modernisierungsschübe erfolgreich Meisternden, die Entheimatungsbefürchtungen und Entfremdungsängste empfinden. Es sind die Anderen, die die Veränderungen durch Globalisierung und durch das Fremde und die Fremden als Gefährdung ihrer vertrauten Lebenswelt, auch als sozialen Verteilungskonflikt erfahren.
Diese Anderen reagieren auf die Öffnung der Grenzen mit dem Wunsch nach neuen Grenzen, mit dem Wunsch zurück zum souveränen Nationalstaat. Sie reagieren auf die postmoderne Vielfalt und den kulturellen Pluralismus mit dem Wunsch nach kultureller Eindeutigkeit von Identitäten, nach verbindlichen Werten, nach nationaler Leitkultur. Man kann auf solche Wünsche mit purer Ablehnung und Verachtung reagieren, was ich allerdings für falsch halte. Die Rechtspopulisten tun das Gegenteil und das erklärt wenigstens zum Teil ihren Erfolg.
Gelingende Demokratie in einer pluralistischen Gesellschaft verlangt nach einem Fundament von Gemeinsamkeiten, nach einer gemeinsamen Antwort auf die Frage nach ihrer politischen Identität. Um der Zukunft der Demokratie willen müssen wir uns immer wieder neu des ethischen und kulturellen Fundaments der Demokratie als politischer Lebensform der Freiheit vergewissern. Gerade in umkämpften Zeiten, in zersplitterter Kommunikation, angesichts von zunehmender sozialer, kultureller und weltanschaulicher Heterogenität haben wir nach dem „Wir“ der politischen Gemeinschaft zu fragen: Wie möchten wir leben? „Als Freie und Gleiche in einem offenen, demokratischen Gemeinwesen oder in einem eher geschlossenen autoritären System? „ (Andreas Voßkuhle).
Die Antwort scheint deutlich schwieriger geworden zu sein – in einer zwiegespaltenen Zivilgesellschaft (die zuvorderst, aber nicht nur an der Flüchtlingsfrage gespalten ist, sondern auch in Ost und West). Es geht in dem Streit um Zugehörigkeit, um Anerkennung, um Teilhabe und am Schluss letztendlich darum, ob es gelingt, einen gemeinsamen Sinn für Zugehörigkeit (Ralf Dahrendorfs „sense of belonging“) zu entwickeln. Je pluralistischer eine Gesellschaft, je streitiger eine Demokratie ist, umso wichtiger werden eben fundamentale Gemeinsamkeiten, umso mehr müssen wir uns darum kümmern, dass die geschwächten gesellschaftlichen Bindekräfte wieder gestärkt werden!
Das ist keine ganz neue Einsicht. Schon bei Adolf Arndt, dem sozialdemokratischen Parlamentarier und Juristen der 50/60er Jahre findet sich der gewichtige Satz: „Demokratie als System der Mehrheitsentscheidungen setzt die Einigkeit über das Unabstimmbare voraus.“
Wir müssen uns dringlich fragen, was zu tun ist in einer immer stärker zersplitterten Gesellschaft, in der Partikularinteressen zu dominieren scheinen, in der der Grundkonsens bröckelt. Je pluralistischer eine Gesellschaft, umso dringlicher die Frage nach grundlegenden Gemeinsamkeiten. Der frühere langjährige Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde hat den (inzwischen endlos oft zitierten) Satz formuliert: „Der freiheitliche säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst garantieren kann.“ Die Sicherung dieser Voraussetzungen, dieses ethischen und kulturellen Fundaments ist Aufgabe der Bürgergesellschaft und darin insbesondere der kulturellen Kräfte und also auch der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.
Die Verteidigung und Stärkung der Demokratie ist deshalb wesentlich auch eine kulturelle Aufgabe. Eine pluralistische und zunehmend heterogener werdende Gesellschaft ist geprägt durch Wert- und Identitäts-Konflikte, also durch Kulturkonflikte. Damit haben wir weniger (positive) Erfahrungen als mit der Austragung von (sozialökonomischen) Interessenskonflikten. In welcher Sprache tragen wir sie aus – zwischen falschem Korrektheitskorsett einerseits und der Sprache der Ausschließung, der Aggressivität, des Hasses andererseits. Darüber müssen wir reden! Wie ermöglichen wir die Erfahrung des Gehörtwerdens (und überwinden das Gefühl, „die da oben wissen nichts von uns, die verstehen uns nicht…“). Das Schließen der sogenannten Repräsentationslücke darf ja nicht heißen, dass Hass und Aggressivität, dass Rassismus und Antisemitismus nun auch im Parlament stattzufinden hätten!
Genau das passiert aber nun: Missstimmung, Wut, Verachtung, Hass – das alles hat nach den Landtags- und Bundestagswahlen seinen Weg in die Parlamente gefunden. Es wird unüberhörbar jetzt auch im Deutschen Bundestag ausgedrückt. Der bisherige parlamentarische Common sense ist durch die AfD aufgekündigt. Wer anfangs, wie manch journalistischer Kommentator meinte erwarten zu dürfen, dass durch den Einzug der AfD die Bundestagsdebatten lebendiger würden, der sollte inzwischen belehrt sein durch deren Auftritte. Hass und Hetze sind keine Lebendigkeit! Gezielte Provokationen befördern nicht die argumentative Debatte – so wenig wie Fouls ein Fußballspiel wirklich bereichern. Mit absichtsvollen rethorischen Tabuverletzungen und politisch-moralischen Grenzüberschreitungen verschieben die AfD-Parlamentarier Sitzungswoche für Sitzungswoche das, „was man doch noch mal sagen darf“. Wir, die Bürger, sollten genau hinhören und hinschauen, was die AfD innerhalb und außerhalb der Parlamente sagt und tut. Welche Sprache sie spricht. Und wir sollten deren „fraiming“ erkennen, die sprachliche Strategie durchschauen lernen.
Demokratie ist Streit, ist Debatte. Sie wird schwieriger angesichts von Rechtspopulisten und –Extremisten in den Parlamenten und angesichts der aggressiven Stimmung im Alltag. Wie gelingt ein demokratischer Diskurs in solchen Zeiten und mit wütenden Bürgern und rechtspopulistischen Ideologen. Es geht darum, die richtige Mischung zu finden zwischen Verstehens-Orientierung und Konfrontationsbereitschaft. Beschimpfungen und Stigmatisierungen helfen nicht. Das Gespräch zu suchen ist übrigens nicht nur Aufgabe von Politikern, sondern es ist Bürgeraufgabe. Als Demokraten sollten wir immer wieder neu versuchen, „Hermeneuten der Wut“ (Bernhard Pörksen) zu werden. Je konkreter, je faktenbezogener, je versachlichender das Streitgespräch, die Problembesprechung ist, umso besser! Dauerempörung über die Anderen ist hilflos. Besser ist der Versuch, falsche Behauptungen sachlich richtig zu stellen, ideologische Motivationen und Absichten sichtbar zu machen. Aber gelegentlich hilft auch nur die Bereitschaft zum entschiedenen Widerspruch.
Wir sollten auf Unterscheidungen achten: Angst und Hass sind sehr verschiedene Emotionen, Angst überwindet man nicht durch Schulterklopfen oder Beschimpfungen, sondern durch Aufklärung, durch Gespräch, durch Begegnung, durch gemeinsames Handeln. Hass (gegen Fremde, gegen Ausländer, gegen Juden, gegen Demokraten) haben wir offensiv und selbstbewusst zu begegnen und zu widersprechen. Die Artikulation von Besorgnissen ist etwas gänzlich anderes als Hetze. Wir sollten in jedem Fall auf solche Unterscheidungen achten und danach handeln.
Zum Schluss: Für das gesellschaftliche Klima ist gewiss (auch) Politik verantwortlich – durch die Art wie sie kommuniziert, durch den Stil in dem sie streitet. Und vor allem dadurch, dass sie immer wieder den Beweis ihrer Handlungskraft und Problemlösungsfähigkeit erbringt.